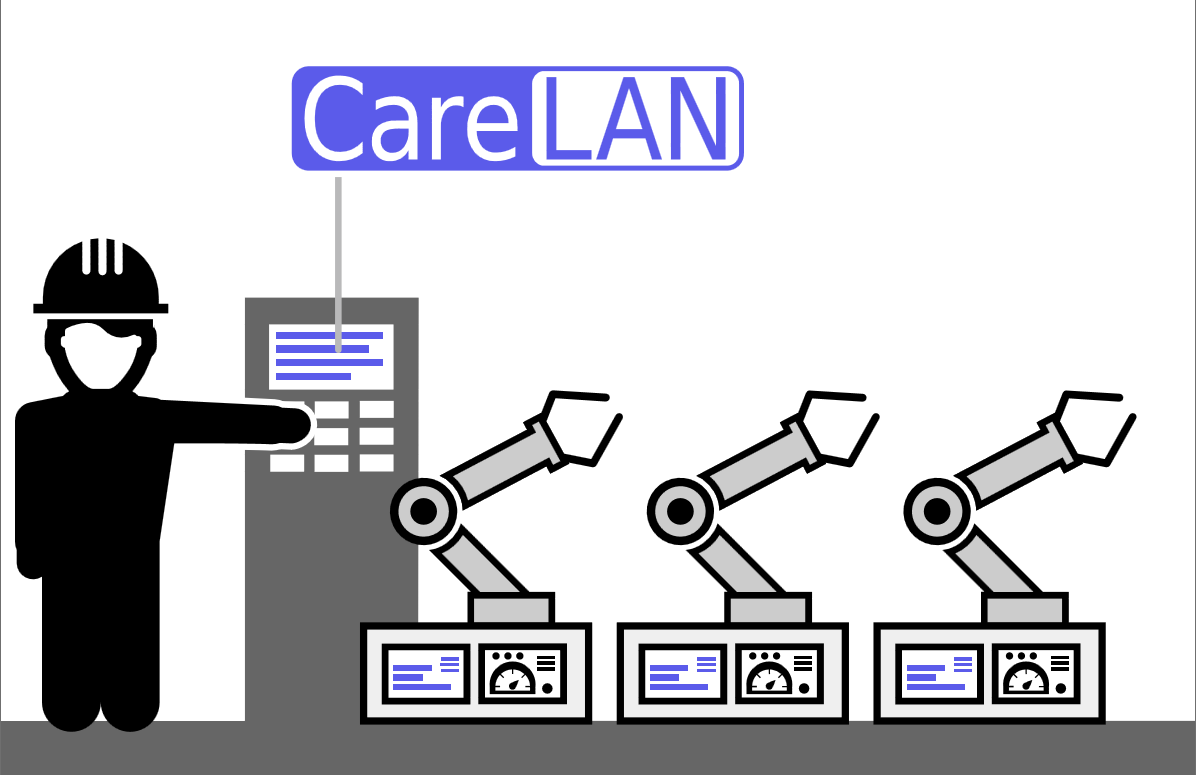Die Ingenieure in den Unternehmen sind oft die ersten, die eine neue Entwicklung erkennen. Sei es, dass sie im Markt eine Bewegung erkennen, oder dass der nächste völlig logische Schritt absehbar ist. Sinkt dann der Aufwand für die Einvernahme einer solchen Entwicklung in die eigenen Produkte, dann verspricht sich jede vorwärts gewandte Industrie von der Integration einen Vorteil. Diese Beschreibung gilt für die industrielle Vergangenheit genau so wie auch für die nun bevorstehende sogenannte 4. Revolution.
Laut einem gut 10 Jahre alten Harvard Business Report scheitern annähernd die Hälfte aller First Mover. Will man den Job als kleiner Wettbewerber zudem noch besser machen als alle anderen, dann liegt die Quote des Scheiterns bei etwa 90%.
Die Mikado-Frage: Der Erste, der sich bewegt, verliert?
Erfolg durch Akzeptanz
Die technologischen Entwicklungen der Vergangenheit werden seit wenigen Jahrzehnten angereichert durch Entwicklungen in der Informations-Technologie: Software ist immer mehr in die Lage versetzt worden mit Sensoren und Aktoren zu interagieren. Miniaturisierung führt zu immer kleineren IT-Komponenten. Vernetzung lässt diese IT-Systeme immer mehr in die reale Welt wirken.
Wie kam das? Die Verfügbarkeit von Technologie, sei es Hardware, Software oder Know-how, ist der Schlüssel für Akzeptanz. Je massentauglicher sie ist, desto eher hat sie das Potential zur Folklore zu werden.
Prosperierende Technologie-Ökosysteme sind solche, deren vielfältige Mitspieler sich gegen die Integration mit anderen nicht verwehren sondern Interoperabilität fördern. Hier haben die Effizientesten den größten Erfolg. Und das gilt auch und erst recht in der Besetzung von Nischen.
Wer rastet, der rostet
In einer Welt der technischen Erfindungen zählt zunehmend der kontinuierliche Vorsprung vor dem Wettbewerb. Das Herstellen von Kopien geht immer schneller. Selbst im Engineering verlieren wir eine Führungsrolle nach der Anderen. Wir müssen also schneller entwickeln als der Wettbewerb.
In der Verbindung von Produkt mit Dienstleistung kündigt sich eine weitere Herausforderung an.
Informationsgesellschaft
Heute verwächst die Informations-Technologie zunehmend mit den Menschen die sie nutzen. Es zeichnet sich ein Bild ab, in dem Mensch und Umwelt auf eine neue Art mit einander verbunden sind. Dies ist ein Metatrend, eine Entwicklung die sich durch viele Bereiche von Technologie und Kultur zieht. Dazu drei empirischen Beobachtungen:
-
Alle 18 Monate erfolgt eine Verdopplung der Komplexität integrierter Schaltkreise und in etwa auch deren Leistungsfähigkeit.
(Moorsches Gesetz) -
Die Kosten der Vernetzung steigen proportional mit der Anzahl der Teilnehmer, der Nutzen steigt proportional mit der Anzahl ihrer möglichen Verbindungen.
(Metcalfesches Gesetz) -
Wenn es mehr als eine Anwendung gibt, dann wird sie früher oder später genutzt werden.
(Murphys Gesetz)
Während (1) und (2) ein positives Bild zeichnen und eine Erwartungshaltung wecken, steckt in (3) eine geradezu delphische Zweideutigkeit. Denn Murphys Gesetz lässt sich auf das Scheitern genau so beziehen wie auch auch auf die „kreative Anwendung“ existierender Technologien. Das schillernde Internet wie wir es heute kennen ist eine solche kreative Anwendung.
Was ist zu tun?
In der Rückschau gibt es keine Zufälle. Jede Entwicklung kann in ihre Beiträge zerlegt werden, deren Zusammenspiel logisch nachvollziehbar zum betrachteten Resultat führen.
Hier zahlt sich die Rendite einer offenen Technologie-Kultur aus. Im Sinne eines „Lean Development“ können erste erfolgreiche Schritte mit geringem Aufwand betrieben werden. Basierend auf der Vorarbeit anderer kombinieren die Entwickler verschiedene Bausteine zu einer Innovation.
Oft ist es bereits heute möglich ein IT-Feature ergänzend, parallel zu bestehenden Produkten einzuführen und erst später, mit gewonnenen Erfahrungen, die Integration weiter zu betreiben.
Innovationen werden zunächst an einer kleinen und exklusiven Serie am Markt erprobt. Wird die Innovation dann betriebssicherer, wird sie in immer umfangreichere Serien ausgerollt; oder mit kleinst möglichen Erkenntnis-Kosten eingestellt.
Beispiel Maintenance und Service
Ein erstes Feature kann die verbesserte Maintenance eines Produktes sein, das bereits über eine Diagnose-Schnittstelle verfügt. Eine zusätzliche mobile Telemetrie-Komponente, eine CareLAN-Box, wird an das Gerät angeschlossen um dem Techniker vor Ort oder auch dem Spezialisten in der entfernten Firmenzentrale einen interaktiven Zugriff auf das Produkt zu ermöglichen. Der Fehlerspeicher und gesammelte Daten werden ausgelesen und zur Zentrale überspielt. Der Techniker vor Ort wird mit Analyse, Diagnose und Montage-Anleitungen unterstützt. Korrekturen können eingespielt werden. Informationen aus dem Gerät werden den Konstrukteuren bereit gestellt, die daraus Verbesserungen kommender Produkt-Generation ableiten.
Die Entwickler erkennen das Potential und richten neue Datenpunkte ein, mit dem Ziel schneller belastbare Erkenntnisse für die Entwicklung zu gewinnen.
Es ist absehbar, dass praktisch alle technischen Geräte Telemetrie-Funktionen besitzen werden. Auch für Services wie die Beschaffung von Verbrauchmaterialien oder die Ersatzteilbeschaffung. Bis eines Tages kompletten Serien ausgestattet werden, können auch stichprobenartig einzelne Exemplare, ausgestattet werden: Etwas mehr Statistik bei deutlich geringeren Kosten.
Telemetrie-Komponenten lassen sich bereits heute mit vertretbarem Aufwand in die Prototypen und 0-Serien integrieren um dann bei Produktionsstart eine valide erprobte Parametrierung verwenden zu können.
Unterschätzte Kompexität
Ein größeres Risiko besteht in der interdisziplinären Komplexität. Da ist beispielsweise der Hersteller einer elektrischen Komponente. Er möchte ein Monitoring-Produkt ergänzend zu seiner Komponente anbieten, welches in die IT und die Leitwarten der Stromnetzbetreiber integriert wird. Die Entwicklung selbst zeichnet sich am Markt ab und der Hersteller möchte diesen Claim besetzen. Der Hersteller benötigt neben dem Know-how für die Herstellung der Komponente nun auch Know-how in der Entwicklung eines Software-Produktes, der Schnittstellenintegration, den Gepflogenheiten, Prozessen, Abläufen und Betriebsanforderungen beim Endanwender. All das geht weit über das ursprüngliche Feld der Herstellung von elektrischen Komponenten hinaus. Allein der Aufbau einer Infrastruktur für die Software-Entwicklung kollidiert mit den gewöhnlichen Anforderungen von Ofifice-, ERP-Arbeitsplätzen und den operativen Netzen.
Wie also ist überhaupt erst einmal die Voraussetzung für eine solche Entwicklung zu schaffen? Geschafft haben hat es der Hersteller mit OKIT als einem auf IT-Integration im Energie-Sektor spezialisierten Unternehmen und mit offenen und engagierten Ingenieuren und Informatikern auf beiden Seiten, die gern voneinander lernen und das Projekt zum fliegen bekommen möchten und mit der flexiblen und sicheren IT-Infrastruktur der OKIT.
In der passende Mischung aus „make“ und „buy“ liegt die Lösung. Know-how für IT-Entwicklung gibt es bei Experten. Das Produkt-Know-how dagegen gibt es im eigenen Haus. Man sollte sich gerade in der Startphase immer nur auf den technischen Lückenschluss konzentrieren und nicht das Rad neu erfinden wollen.
Wer liefert was?
Entwicklung sollten in kontinuierlichen, kleinen Schritten erfolgen: „Continuous Integration“. Mit interdisziplinär zugänglichen Experten aller Gewerke und mit darauf spezialisierten IT-Entwicklungs-Partnern. Denn betrachtet man solche Projekte später in der Rückschau, so wird man feststellen, dass die Team-Zusammenarbeit der passenden Experten in einem fruchtbaren Umfeld zu einer erfolgreichen Entwicklung geführt hat.
Es ist nicht überraschend, das vor allem internationale Technologie-Konzerne das Feld Industrie 4.0 besetzen möchten. Industrie 4.0 ist aber kein Zukaufprodukt.
Unternehmen, die auf der Suche nach Innovationspotential für die eigenen Produkte sind, sollten selbst Anwendungsfälle identifizieren. Spezialisten können hier unterstützende Hinweise zur Machbarkeit von Ideen geben und den Prozess begleiten.
Beispiel Lean Approach
Da ist beispielsweise ein Erdbauunternehmen. Die Baumaschinen können mit kostspieligen Messgeräten für mehrere 10t€ ausgestattet werden um Daten in proprietären Formaten zu sammeln. Viele Fahrzeuge werden nur temporär und von wechselnden Anbietern angemietet, weshalb eine Festinstallation der Gerätschaften nicht tragbar ist. Eine Vielzahl von Herstellern bedeutet viele Schnittstellen. Selbst wenn also alle Geräte Daten erheben und verwenden können: Ein ganzer Zoo von Datenformaten strömt also auf die Bauleiter ein.
Ein einheitliches System zur Verarbeitung all dieser Daten von den zahlreichen verfügbaren Gerätschaften wäre ein IT-Großprojekt.
Der alternative Ansatz, mit kleinen Schritten und mit überschaubarem Aufwand nützliche Informationen zu gewinnen, offenbart seinen Charme: Anstelle der kostspieligen und fest installierten Geräte, werden Smartphones und aus gängigen am Markt verfügbaren Standard-Komponenten assemblierte mobile Geräte verwendet, die einmal in ein Fahrzeug gelegt ohne jede Benutzer-Interaktion ein Lagebild der Baustelle liefern. Aus den gelieferten Daten können viele nützliche Informationen gewonnen werden und kontinuierlich ergeben sich zusätzliche Ansätze.
Ein innovatives Team aus Bau- und IT-Spezialisten entwickelt so mit überschaubarem Aufwand nützliche Mehrwerte.
Produktentwicklung ist Betriebsgeheimnis
Gerade bei der Produktentwicklung sollte jedes Unternehmen sehr vorsichtig in der Wahl seiner Partner sein. Das ist ein Plädoyer für regional ansässige IT-Entwicklungs-Unternehmen, die Gesicht zeigen, sich auf die Bedürfnisse der Kunden verbindlich einlassen und auch vor Know-how-Transfer keine Angst haben. Vor diesem Hintergrund befremdet der in die USA gewandten Blick vieler europäischer Unternehmen. Wir sollten das durchaus auch selbst schaffen können.
Fazit
Zu der Mikado-Frage vom Anfang: Fehler bei der Entwicklung sollten vermieden werden, um einen Beitrag zur Zukunftssicherung zu liefern.
Die genannten Beispiele verwenden verfügbare und beherrschbare Technologien und kombinieren diese mit überschaubaren Aufwänden zu neuen, innovativen Anwendungen. In der Folge bilden sie das Fundament für wiederum neue und noch innovativere Anwendungen.
Keine Forschung also, sondern Lean-Entwicklungen mit festen Budgets und definierten Zielen. Dabei immer im Blick: die konsequente Verbesserung und Optimierung von Prozess und Wertschöpfung.